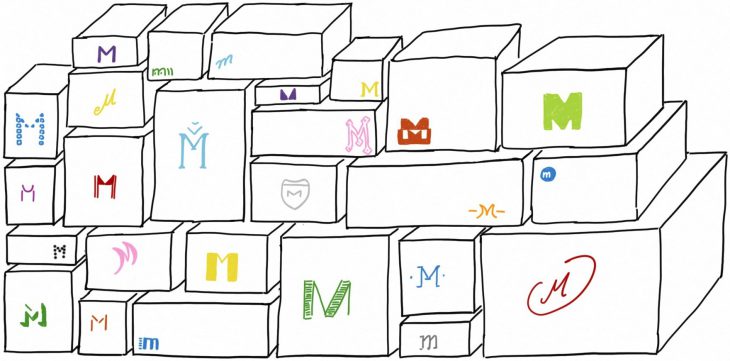
Der erste Teil beschrieb eine Grob-Aufteilung in Edel-, Beziehungs-, Preis-, Händler-Marken und Güte-Label und wie Hersteller dafür sorgen, möglichst starke Marken aufzubauen und deren Erfolg langfristig zu erhalten. Wieso dieses Unterfangen überhaupt gelingen kann, ist mit den Bedürfnissen der Käufer bzw. Nutzer zu erklären.
Aus Sicht der Konsumenten koordinieren Marken unseren Einkaufsalltag. Das geht weit darüber hinaus, nur Coca Cola in den Einkaufswagen zu lassen, weil „mir alle anderen Cola-Sorten nicht schmecken“. In dem Fall trifft möglicherweise das Markentreue-Argument gar nicht, sondern es handelt sich eher um eine Sorten-Präferenz. Markentreue zeigt sich vor allem, wenn neue Produkte ausgesucht werden (also eben nicht das selbe noch mal). Dabei werden aus verschiedenen Alternativen bewusst einige nicht wegen Produkteigenschaften, sondern aufgrund der Marke ausgeschlossen oder bevorzugt.
In einer verqueren Zuspitzung fungieren Marken genauso wie die Auswahl eines Sexualpartners: Der oder die Suchende schließt bewusst bestimmte Personen nach „willkürlichen“ Parametern aus: Geschlecht, Körpergröße, Gewicht, Alter, Haarfarbe und -länge, Gesichtsform, Fußgröße, Geruch, etc. Diese Vorselektion wäre von der suchenden Person auf Nachfrage nur teilweise rational erklärbar, viele Kriterien werden unbewusst angewendet. Genauso wie Mann A vielleicht brünette, mittelgroße Frauen bevorzugt, wird Mann B Produkte der Firma X präferieren. Möglicherweise haben A und B mit anderen bereits schlechte Erfahrungen gemacht, interessieren sich aus verschiedenen Gründen gar nicht für andere oder wollen positive Erfahrungen wiederholen.
Die Qual der Wahl
Bereits der Blick in ein Schuhgeschäft zeigt: Schuhe sind mehr als Fußschutz oder -bekleidung. Dutzende Modelle in allen Farben und Formen buhlen um unseren Geldbeutel. Es gibt zwar nur eine überschaubare Menge an Grundformen – diese aber in allen Variationen. Gleiches gilt für Laptops, Fernseher, Joghurts, Käsesorten, Schreibtische, Lampen, Socken, Jacken. Für jede Produktgruppe gibt es starke und schwache Marken. Selbst Menschen können zur Marke werden wie ein „Spielberg-Film“ oder ein „Colani-Design“.
Die Unterschiede liegen auf anderer Ebene:
- Preis
- (schmückende) Details: funktionslos, aber ästhetisch bereichernd
- Verarbeitung
- Nutzungs- bzw. Tragekomfort
- Erfahrungen, Erwartungen
Beispiel Schuhkauf
Beim Schuhkauf hat es sich – für mich – bewährt, zunächst die mir bekannten Marken durchzusehen. Wieso? So wird meine Entscheidung erst einmal überschaubar: Statt Tausender Schuhe brauche ich nur wenige Dutzend zu begutachten und bei Gefallen anzuprobieren. Ich weiß in etwa, wie stark die Belastung für mein Konto sein wird und welche Qualität ich erwarten kann.
Nur wenn ich nicht fündig werde (weil die gewünschte Farbe fehlt oder mir kein Modell gefällt), haben die anderen Marken eine Chance. Aber nicht alle! Gegen einige habe ich irrationale Vorbehalte. Die kommen nicht mal ansatzweise in die engere Wahl. „Sowas trage ich nicht. Punktum.“
Fiktives Sex-Beispiel
Stellen wir uns vor, statt aus Hunderten von Schuhen würden wir aus Hunderten von Menschen einen Sex-Partner wählen können. Sofort setzt der Auswahlmechanismus ein:
- Heterosexuelle schließen Menschen des gleichen Geschlechts aus. Homosexuelle die des anderen Geschlechts, Bisexuelle schließen kein Geschlecht aus, und Pansexuelle ignorieren das Geschlecht.
- Bestimmte Haarfarben, Frisuren, Körpergrößen, Augenfarbe und ähnliche Faktoren führen zum weiteren Ausschluss.
- Wir beurteilen, wie die Person sich präsentiert, steht sie locker oder verkrampft, lächelt sie oder schaut verkniffen.
- Irgendwelche persönlichen Präferenzen, Vorlieben oder Interessen beeinflussen unsere Auswahl weiter, beispielsweise Tattoos, Kleidungsstil, Piercings, Schmuck und Pflege der Hände, Gestalt der Ohren, etc.
So haben wir eine scheinbar rationale und nachvollziehbare Vorauswahl getroffen. Aber der Teufel verbirgt sich in einem besonderen Zusatzaspekt. In der fiktiven Welt könnten wir völlig frei wählen. In der realen Welt wären wir darauf angewiesen, dass die gewählte Person die Wahl akzeptiert. Daher greift ein weiteres Kriterium: die Attraktivität. Ganz vereinfacht könnte die Attraktivität jeder Person auf einer Skala von 1 bis 10 erfasst werden. Die Chancen, dass eine Wahl akzeptiert würde, steigt, wenn der Attraktivitätswert der gewählten Person niedriger als jener der wählenden Person ist. Eine Person mit Attraktivität 7 würde also gute Chancen bei Personen von 1 bis 6 haben.
Die Erfahrung (und Studien) lehrt uns, dass es reale Chancen bis zur nächsthöheren Attraktivitätsstufe geben kann, das wäre in dem Beispiel eine 8. Aber Personen mit 9 und 10 sind quasi ausgeschlossen, jedenfalls enorm unwahrscheinlich. Nun sind aber Menschen schlecht in der Lage, ihre eigene Attraktivität halbwegs realistisch einzuschätzen. Die Person mit 7 hätte also eher eine tatsächliche Attraktivität von 6, nur an ganz besonders guten Tagen würde eine 7 herauskommen können. Die Selbst(fehl)einschätzung führt also zu einer Auswahl, die einiges an Ablehnungsrisiko birgt.
Wer bekommt den „Zac Efron“ unter den Schuhen?
 Bei Marken funktioniert es ähnlich: Unserem Selbstbild zufolge sind wir uns die besten Materialien, Verarbeitungen und überhaupt nur das Beste vom Besten wert. Die Chancen werden hier aber weniger durch Attraktivitätslevel gesetzt, sondern durch den Geldbeutel. Um den „Zac Efron“ unter den Schuhen wählen zu können, braucht es schon den nötigen Puffer auf dem Konto.
Bei Marken funktioniert es ähnlich: Unserem Selbstbild zufolge sind wir uns die besten Materialien, Verarbeitungen und überhaupt nur das Beste vom Besten wert. Die Chancen werden hier aber weniger durch Attraktivitätslevel gesetzt, sondern durch den Geldbeutel. Um den „Zac Efron“ unter den Schuhen wählen zu können, braucht es schon den nötigen Puffer auf dem Konto.
Ein Abteilungsleiter wird beispielsweise Billig-Schuhe oder No-name-Exemplare ausschließen. Diese passen nicht zu seinem Selbstbild und zu dem Bild, das er der Welt von sich vermitteln möchte. Jemand mit schmalem Budget wird die Vorzüge des „Zac Efron“-Schuhs erkennen können (sofern er oder sie sich für Schuhe interessiert und das nötige Wissen um Materialien, Qualität usw. besitzt), aber sie sich nicht leisten können. Also sucht diese Person in ihrem Preis-Segment das Exemplar, das „Zac Efron“ am nächsten kommt.
Marken sind zwar letztlich mehr als nur Preis-Segmente. Aber die Analogie zum Sex-Partner verdeutlicht, dass viele Nebenaspekte mit hineinspielen: Selbstbild, Selbstwert, Anerkennung durch andere, Wünsche, Träume und unsere unbewussten Steuerungen. Leonard Mlodinov berichtet im Buch „Subliminal. How Your Uncounscious Mind Rules Your Behaviour“ von einem Markenexperiment: Im Blindtest bevorzugten die meisten Testteilnehmer den Geschmack von Pepsi-Cola. Wussten sie vor dem Probieren, welche Marke sie verkosten, bevorzugten sie Coca-Cola. Der Hirnscan verriet den Unterschied: Bereits der Gedanke an die Marke Coca-Cola löst Freude aus. Der „bessere“ Geschmack entsteht im Endeffekt durch die unbewusste Interpretation und Aufladung der sensorischen Wahrnehmung mit den positiven Assoziationen, derer sich die Probanden gar nicht bewusst sind.
 In der Cola-Frage mag es noch halbwegs egal sein, bei welchem der sehr ähnlichen Getränke unbewusste Hirnreaktionen die Geschmacksempfindung übersteuern. Der erlebte Genuss ist für den Trinkenden angenehm. Dagegen sagt die Auswahl des Sex-Partners nichts über die dann erlebte Befriedigung aus. In der Hinsicht spielen Erfahrungen eine besondere Rolle und geben weitere Auswahlkriterien an die Hand. Gleichermaßen weiß der kundige Schuhkäufer ebenso, worauf er achten muss, um das qualitativ beste Modell für sein verfügbares Budget zu erhalten.
In der Cola-Frage mag es noch halbwegs egal sein, bei welchem der sehr ähnlichen Getränke unbewusste Hirnreaktionen die Geschmacksempfindung übersteuern. Der erlebte Genuss ist für den Trinkenden angenehm. Dagegen sagt die Auswahl des Sex-Partners nichts über die dann erlebte Befriedigung aus. In der Hinsicht spielen Erfahrungen eine besondere Rolle und geben weitere Auswahlkriterien an die Hand. Gleichermaßen weiß der kundige Schuhkäufer ebenso, worauf er achten muss, um das qualitativ beste Modell für sein verfügbares Budget zu erhalten.
Während beim Sex die Erwartung und Vorfreude das tatsächliche Erleben und die Genusswahrnehmung beeinflussen, ist diese Komponente beim Schuhkauf weniger einflussreich. Unbequeme, drückende oder schlecht verarbeitete Schuhe können die größte Vorfreude oder aufgeladenste Erwartung nicht rehabilitieren. Der Schuhkäufer wichtet daher seine Auswahlkriterien anders als der Cola-Aussucher oder Sexpartner-Suchende.
Fehlen ihm die Erfahrungen, greift er auf externe Empfehlungen zurück (Test-Berichte, Beratung). Der Durchschnittsdeutsche hat mit weniger als 10 Personen in seinem Leben Sex, verfügt also über wenig Erfahrung, um daraus Auswahlkriterien abzuleiten. Seine Entscheidung wird viel von Wunsch-Denken geleitet. Glücklicherweise kann man im Schuhgeschäft die Kandidaten anprobieren und so erleben, ob zumindest eine Grundzufriedenheit eintritt. Ob die Zufriedenheit lange anhält, ergibt sich erst in den folgenden Monaten. Die eintretende oder ausbleibende Zufriedenheit wird dann beim nächsten Schuhkauf die Auswahl beeinflussen.
Starke und schwache Marken
So wie es bei der Sex-Partner-Wahl für jede Person harte und weiche Kriterien gibt, werden harte und weiche Kriterien beim Schuhkauf angelegt: Wer Halbschuhe sucht, wird weder Stiefel noch Sandalen in die engere Wahl nehmen (hartes Kriterium). Ob die Halbschuhe mit Schnürsenkeln, Klettverschluss oder Schnallen sind, kann ein weiches Kriterium sein – abhängig vom Schuhkäufer. Letztlich legt jeder individuell für sich fest, was er tatsächlich sucht, was ihm sehr wichtig, weniger wichtig oder gar unwichtig ist.
Eine ähnliche Relevanz-Hierarchie besteht bei Marken. Eine „starke Marke“ bedeutet eine klare Einstellung des potenziellen Konsumenten, beispielsweise Bevorzugung oder Ablehnung. „Schwache Marken“ dagegen sind neutral, der Kunde kennt sie zwar, hat aber (noch) keine ausgeprägte Meinung zu oder über diese. „Egale Marken“ kennt der potenzielle Konsument noch nicht.
Daraus ergibt sich bei der Entscheidung für ein neues Produkt eine Auswahlkaskade:
- Gibt es ein geeignetes Produkt von einer starken positiven Marke?
- Wenn nicht: Kann ich starke negative Marken ausschließen?
- Gibt es geeignet scheinende Produkte von schwachen Marken?
- Wenn nicht: Finde ich bei den egalen Marken etwas Geeignetes?
Viele Konsumenten gelangen jedoch kaum bis zu Punkt vier. Die Bereitschaft, die Kaskade zu durchlaufen, hängt vom Sortiment und der Kaufsituation ab. Beispielsweise werde ich in absehbarer Zeit im Laptop-Sortiment nur Produkte der für mich starken positiven Marke „Apple“ in Betracht ziehen. Andere Suchende präferieren in ähnlicher Weise Asus, Sony oder Dell – entweder von dieser Marke oder (heute) eben nichts. Bei Kleidung haben viele Konsumenten ähnliche Muster: Anzüge müssen von „Boss“ sein, Hemden von „H&M“, Sportschuhe von „Adidas“, Socken von „Falke“ usw. Etwas anderes kommt nicht in die Tüte.
Besteht die Kaufsituation darin, etwas tatsächlich kaufen zu müssen (weil beispielsweise eine Hose oder ein Paar Schuhe wirklich benötigt werden), hat die skizzierte Kaskade eine andere Auswirkung als im Stöbermodus. Angeblich sollen Frauen weniger markenaffin agieren als Männer. Sie würden eher auf Sortiments- oder Produktebene selektieren, und Marken wären allenfalls Hilfskriterien. Letztlich bedeutet das jedoch nur die praktische Auswirkung davon, dass die Relevanz von Marken sich bei jeder Person in anderen Sortimenten zeigt.
Flexible Markentreue
Für manche Produktkategorien ist der Konsument festgefahren und fixiert, bei anderen höchst flexibel. Beispielsweise ist mir beim Käsekauf die Marke ziemlich egal, lecker muss das Objekt aussehen und zu meiner Vorstellung passen, auf einer frischen Scheibe Brot verzehrt zu werden. Sicher greife ich immer wieder zur selben Sorte, aber wenn ich Zeit habe, genieße ich das Stöbern und Entdecken.
Die Kaskade kann also Zeit sparen und das Risiko minimieren: Schließlich weiß ich bereits im Vorfeld ziemlich genau, was ich bekomme. Negative Überraschungen sind unwahrscheinlich. Das reduziert das Risiko eines Fehlkaufs. Genauso kann ich bei mir bekannten Bekleidungsmarken blind online bestellen oder im Laden ohne Anprobe direkt zur Kasse gehen. Ich kenne deren Schnitt- und Größenverständnis und weiß, was mir passen wird.
Somit erfüllen Marken im Einkaufsalltag ganz pragmatische Funktionen:
- Entscheidungsbeschleunigung durch Vorselektion auf das Teilsortiment einer Marke
- Risikominimierung durch Erwartungskonformität
- Planungssicherheit durch Erwartungskonformität
- letztlich Zeitersparnis durch Komplexitätsreduktion
Angst vorm Fehlkauf
Für FMCG (fast moving consumer goods, Verbrauchsgüter) gibt es zwei Arten von Markentreue. Die eine bezieht sich auf eine konstante Qualität und Erwartungskonformität des selben. Wird das selbe Produkt erneut gekauft, beispielsweise Wurst, Haushaltsmittel oder andere sich verbrauchende Güter, ist die Markentreue weniger relevant. Vielmehr sorgt die Produkt-Präferenz für Risikominimierung und die anderen genannten Effekte. Wird jedoch ein neues Produkt gewählt – weil das bislang präferierte nicht (mehr) erhältlich ist, ein neuer Bedarf zu decken ist, Abwechslung gesucht wird oder Neugier leiten –, kann die Markentreue wirken. Je ähnlicher der Verwendungszweck oder Nutzungskontext des neuen Produkts zu einem Produkt ist, desto eher findet eine Übertragung der Markenerwartung statt.
Bei langlebigen Gütern, die kontinuierlicher Veränderung unterliegen, wie Mode und Technik, wirkt Markentreue sehr effektiv, indem sie das Vertraute (die Marke) mit dem Neuen (ein neues Kleidungsstück oder Gerät) verbindet.
Wenn wir ehrlich sind: Um ein T-Shirt in einem mittelgroßen Bekleidungsgeschäft zu kaufen oder ein paar Schuhe, würde ein halber Tag benötigt, wenn man alle (!) potenziell geeigneten Modelle durchprobieren würde, bis man das perfekte (oder wenigstens das am wenigsten ungeeignete) Stück gefunden hat. Und selbst dann hat man keine Gewähr, dass die Qualität hält, was wir uns erhoffen. Das T-Shirt kann einlaufen, eine Schuh-Naht kann sich lösen, der Stoff verschleißt ruckzuck, die Sohle ist nach wenigen Wochen schiefgelaufen.
Natürlich können wir auch Glück haben, und das Shirt oder die Schuhe übererfüllen unsere Erwartungen – aber psychologische Studien haben gezeigt, dass Menschen tendenziell eher risikoscheu sind. Sie zahlen lieber einige Euro mehr und leben im Gefühl der Sicherheit. Keine Experimente, bitte. Das ist sozusagen die Privatversion des 1980er-Spruchs „No one got ever fired for buying IBM.“
Um beispielsweise eine neue Kopfschmerztablettenmarke auszuprobieren, muss erheblicher Leidensdruck bestehen. Einmal Aspirin – immer Aspirin. Die haben immer geholfen, da weiß ich, was mir geschieht. Gerade bei direkt erlebbaren Leiden wie Kopfschmerzen ist das Verlangen nach Risikominimierung verständlich. Etwas anderes als das Bekannte wird nur in Notfällen ausprobiert: Wenn das Bekannte nicht zur Hand und nicht beschaffbar ist oder wenn das Bekannte (wiederholt) nicht die erhoffte Linderung bringt. Geht es um leichte Kopfschmerzen, die nicht direkt den Leiden zugeordnet werden, sondern eher allgemein die Lebensqualität mindern, besteht allerdings durchaus Experimentierwille, „vielleicht geht es mir mit dieser Droge da ja noch besser als mit der bekannten.“
Marken in der neuen Welt
Da es uns unmöglich ist, für alle Sortimente das Wissen aufzubauen, welchen Marken wir qualitativ vertrauen können, gibt es Mittelsmänner, die uns beraten. Edelkaufhäuser, wie einstens Hertie, Karstadt, Peek & Cloppenburg, Galeria Kaufhof, selektieren die schiere Produktmenge vor. Nur hinreichend „würdige“ Marken landen im Angebot. Wer dort einkauft, kann nicht viel falsch machen. Das war einmal.
Etablierte Marken nutzen ihre Bekanntheit und werden zu ihren eigenen Kaufhäusern. Von „Boss“ gibt es Unterwäsche, Anzüge, Schuhe, Taschen, Socken, T-Shirts, alles, was man(n) und frau anziehen kann – auch noch aufgeteilt in verschiedene Unter-Marken – je nach Lebensstil. Viele Marken entwickelten sich so von Spezialisten zu Vollsortimentern in ihrem Bereich.
Hat ein Kunde sich für eine starke positive Marke in einem Teilsortiment entschieden, kann sich dieses auf andere Sortimente übertragen und ausweiten. Der Kunde erleichtert sich das Leben, indem er sich einer Marke so weit anvertraut, dass er deren Angebot in all ihren Sortimenten den Vorzug gibt.
Woher der Preis kommt
 Um ein Produkt herzustellen, bedarf es einer Summe X, beispielsweise würde ein Anzug, der seiner grundsätzlichen Bekleidungsfunktion nachkommt, für 200 Euro zu kaufen sein. Aber: vielleicht möchte ich ein besonderes Material, bevorzuge eine bestimmte Verarbeitung, genieße einen persönlichen Anpassungs-Service oder lege Wert auf irgendwelche Details, die die Grundfunktion des Anzugs kaum aufwerten. Wer einen Anzug für 600 Euro kauft, erhält keinen Anzug, der dreimal besser ist als einer für 200 Euro.
Um ein Produkt herzustellen, bedarf es einer Summe X, beispielsweise würde ein Anzug, der seiner grundsätzlichen Bekleidungsfunktion nachkommt, für 200 Euro zu kaufen sein. Aber: vielleicht möchte ich ein besonderes Material, bevorzuge eine bestimmte Verarbeitung, genieße einen persönlichen Anpassungs-Service oder lege Wert auf irgendwelche Details, die die Grundfunktion des Anzugs kaum aufwerten. Wer einen Anzug für 600 Euro kauft, erhält keinen Anzug, der dreimal besser ist als einer für 200 Euro.
Aber der 600-Euro-Anzug hat in irgendwelchen Details einen Vorsprung gegenüber dem 200-Euro-Exemplar: im Material, in der Verarbeitung, im Schnitt, in der Haltbarkeit, in den Herstellungsbedingungen, etc. Der 600-Euro-Anzug wird vermutlich den Träger besser kleiden als der 200-Euro-Anzug. Je nach Anlass und Situation wird der Träger das eine 600-Euro-Modell dem 200-Euro-Modell vorziehen. Diese Präferenz basiert jedoch weniger auf funktionalen Aspekten der Kleidung (Schutz, Taschen für Aufbewahrung von Schlüssel, Taschentuch oder Kleingeld, Geeignetheit für Gehen, Sitzen und andere Bewegungen) als vielmehr auf den beiden miteinander verwobenen Gebieten: Tragegefühl und Außenwirkung. Diese sind dem 600-Euro-Anzug-Träger in diesem Fall einen Aufpreis von 400 Euro wert.
Noch zugespitzter: Ein 2.000-Euro-Anzug ist keinesfalls zehnmal besser als ein 200-Euro Anzug. Aber er verfügt über Eigenschaften, die dem Käufer den Aufpreis wert sind. Das liegt auch an der Einschätzung des Kunden: Die reinen Basis-Aspekte (functionality und reliability gemäß der buying hierarchy) werden als gegeben gesehen und der Hauptwert liegt in den Convenience-Features des Anzugs.
Das entspricht ganz grob dem Verständnis bei der Pareto-Verteilung. Für 200 Euro erhalte ich einen Anzug, der alle funktionalen Anforderungen an einen Anzug hinreichend erfüllt (eben die berühmten 80 Prozent). Für jede weitere Anforderung, wie Design, Verarbeitung oder Service, zahle ich einen nicht-proportionalen Aufschlag (eben die zunehmend teuren verbleibenden 20 Prozent).
Für 300 Euro erhalte ich einen Laptop, der grundsätzlich funktioniert. Für 1000 Euro erhalte ich einen Apple-Laptop, der mein Leben erleichtert. Der Aufpreis wird beispielsweise mit einer besonderen Verarbeitungsqualität, einer besonders komfortablen Mobilität und besonders angenehm zu nutzender Software gerechtfertigt. Benötige ich ein besonders bequem zu transportierendes Gerät, werde ich mich über das 300-Euro-Gerät ständig ärgern, da es mir Kompromisse abverlangt. So fühlen sich die 300 Euro bald nach weggeworfenem Geld an.
Wenn’s billiger sein soll
Die zunehmend automatisierte Produktion sämtlicher Konsumgüter hat zu einer steten Qualitätssteigerung geführt. Die Schwankungen innerhalb einer Produktions-Charge sind minimal. Selbst wer billig einkauft, kauft risikoarm. Das Produkt erfüllt genau seine Anforderungen – aber auch nicht mehr. Für jedes Produkt ließe sich der optimale Herstellungspreis ausrechnen. Dieser ist vielen Konsumenten im Massenmarkt jedoch zu hoch.
Um ein solches Produkt günstiger anbieten zu können, müssen also Kosten gespart werden: billigere Ausgangsmaterialien, weniger Aufwand in der Herstellung, kürzere Entwicklungszeit und geringerer Testaufwand, weniger Qualitätskontrolle, billige Verpackung, etc. Wer also beispielsweise ein Tablet unter 300 Euro kauft, geht bereits beim Kauf bewusst Kompromisse ein, denn an irgendeiner Stelle musste gespart werden, um das Gerät so günstig verkaufen zu können:
- Rechenleistung: Prozessor, Speicher, Rechen-Komponenten
- Ausstattung: Kamera, Lautsprecher, Bildschirm, Anschlüsse
- Verarbeitung: Robustheit, unsaubere Kanten, Reparierbarkeit
- Mobilität: Gewicht, Handlichkeit, Akku-Laufzeit
- Zukunftssicherheit und Einsatzzweck: beschränkt
- Software: nicht optimal auf das Gerät angepasst
- Qualitätskontrolle: von der Herstellung bis zur Auslieferung
- Tablet-Erlebnis: Kombination aus allen Defiziten
Natürlich lügen alle Hersteller darüber, was ihre Geräte können und wie hoch die tatsächlichen Herstellungskosten sind. Der Kunde kann somit gar keine vernünftige Entscheidung treffen – er vertraut also Marken und deren Verlässlichkeit, gegebene Versprechen einzuhalten.
Übrigens sind Tests ebenso Marken wie die Kaufhäuser: Es gibt starke Test-Marken, denen Kunden vertrauen (für viele Kunden beispielsweise die Befunde der „Stiftung Warentest“) oder sie ablehnen. Schwache und egale Test-Marken werden nur konsultiert, wenn sie die bereits gefühlte Kundenmeinung weiter unterstützen. Nur selten sind sie stark genug, eine Meinung zu verändern. Denn Meinungen lassen sich ungern von Fakten beeinflussen ;-)
Marken clustern das Angebot
Würde ich jede Entscheidung meines Lebens bewusst und rational treffen – ich käme zu keiner Entscheidung. Einige beispielhafte Alltagsentscheidungen illustrieren das Dilemma:
- Lege ich mir Scheibenkäse X aufs Brot oder Y?
- Sind Eier „aus Bodenhaltung“ besser als jene ohne diesen Vermerk?
- Welchen Film schaue ich mir an?
- Fahre ich mit Fahrrad, ÖPNV oder Auto auf Arbeit?
- Widme ich dem Artikel in Magazin X eine halbe Stunde meiner Aufmerksamkeit?
- Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle Taschentücher her?
- Welche Zahncreme soll ich kaufen?
- Welche CD kaufe ich mir?
Weniger wagen
Als Kind war ich experimentierfreudiger und riskierte mehr. Letztlich war das Risiko jedoch geringer, denn die Erwachsenen um mich herum konnten im Fall einer Fehlentscheidung eingreifen oder zumindest beraten. Doch mit jedem Lebensjahr wächst mein Wunsch, möglichst wenig Lebenszeit zu verschwenden. Der Wagnis-Anteil schwindet oder wird auf bestimmte Bereiche reduziert. Im überwiegenden Rest meines Lebensalltags möchte ich kein Käsesortenstudium aufnehmen oder Filmenzyklopädien wälzen oder Grüner-Fußabdruck-Berechnungen anstellen.
Bei all diesen Entscheidungen helfen mir Marken:
- Mit Grünthaler Käse habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
- „Aus Bodenhaltung“ klingt irgendwie tierfreundlicher, fast wie „Bio“.
- Filme von Orson Welles, Richard Linklater, Francis Ford Coppola oder Peter Jackson sind immer eine gute Wahl. Disney und Pixar liefern unterhaltsame Kost.
- ÖPNV ist mir zu umständlich, also Fahrrad – außer, das Wetter gefällt mir nicht.
- c’t lohnt sich eigentlich immer. Galore ebenso. Früher auch gern Eulenspiegel, DVD Magazin und Cinema – aber die sind schlecht geworden.
- Mir ist die Sorte egal, ich erbitte mir ein Taschentuch oder hole mir die günstigste Packung im Laden um die Ecke.
- Wie hieß doch gleich die Sorte, die mir der Zahnarzt empfohlen hat?
- Mike Oldfield geht immer, Alan Parson’s Project ebenso, Adam Lambert, The Coral oder The Archive überzeugen immer. Und Barbra Streisand sowieso – sofern ich in der Stimmung dafür bin ;-)
Würde ich für diese Fragen keine vorgefertigten Default-Antworten haben, wäre der Tag um, bevor ich auch nur die Hälfte fundiert beantwortet hätte. Die Default-Belegungen resultieren aus verschiedenen Quellen:
- eigene persönliche Erfahrungen
- fremde Erfahrungen (Hörensagen)
- fachliche Beratung, Empfehlung
- Kurzmeinung (Bio ist besser als Nicht-Bio – aber nicht um jeden Preis)
- Neugier (resultierend aus Berichten, Empfehlungen, Werbung)
Ob die Default-Belegung greift, hängt von der aktuellen Situation ab:
- Gibt es Produkte entsprechend meiner Default-Wahl?
- Bin ich vielleicht in der Stimmung für bewusstes Ausprobieren und riskiere etwas Neues?
- Werden andere Produkte in einer Weise angeboten, dass ich sie als Alternative akzeptieren kann?
- Passt mein gerade verfügbares Budget zu meiner Default-Belegung?
Default-Entscheidung
Dank der Default-Belegung verliere ich wenig Zeit mit umständlichen Abwägungen und Recherchen. Bei einigen dieser Entscheidungen sind Marken das Hauptkriterium. Damit der Alltag nicht ganz so spießig und vorhersehbar ist, gibt es bei jedem Großeinkauf zehn Spontanminuten. In diesen beschäftige ich mich beispielsweise eingehender mit der Käsetheke und wähle ein oder zwei Sorten, die ich noch nicht kenne. Bei der Musikauswahl ist mir der Radiosender meines Vertrauens (radio eins) seit Jahren ein treuer Inspirator. Bei Kleidung lasse ich mich gelegentlich auf einen Shopping-Bummel ein, wenn ich gar nichts brauche, sondern nur begleite. So entdecke ich die interessantesten Stücke – nur an den für mich negativen starken Marken husche ich vorbei, aber schon zahlreiche Stücke von egalen Marken haben es so in meinen Kleiderschrank geschafft. So profitiere ich ganz direkt von der Vorauswahl meiner Händler-Marke: bei Käse, Musik, Bekleidung.
Natürlich ist das Image einer Marke mit-entscheidend, je nach Produktkategorie hat es bei mir unterschiedliche Gewichtungen:
- Lebensmittelkauf, Spontanauswahl (20%): Entscheidender als die Marke ist, dass das Produkt mich anspricht. Und solange ich nichts Negatives mit der Marke assoziiere, kann ich zugreifen. Außer bei „Rügenwalder“. Da geht gar nichts. Deren Werbespots haben mir eine Antipathie verpasst. Dagegen hat Weihenstephan es irgendwie geschafft, im Zweifelsfall bei Milchprodukten erste Wahl zu sein. Müller dagegen ist nur in Notfällen opportun (denen nehme ich immer noch übel, dass sie Anfang der 1990er zahllose Molkereien im Osten aufgekauft haben – nur um sie zu schließen und lokale Konkurrenz zu verhindern).
- Lebensmittelkauf, Auffüllen der Bestände (—): Da wird gekauft, was benötigt wird und sich bewährt hat. Das ist eine wilde Mischung aus Marken, Sonderangeboten und Preis-Marken.
- Technikkauf (75%): Apple, Sony, Panasonic sind immer okay. Philips und Pionieer geht gar nicht (keine Ahnung wieso, einfach eine Aversion). Der Rest ist abhängig von der benötigten Funktionalität. Samsung ist für Monitore erste Wahl, aber in allen anderen Kategorien außen vor.
- Schuhkauf (75 %): Camel Active haben die perfekte Mischung aus Preis, Qualität und Tragekomfort. Alles andere sind Glückskäufe, wie Sioux, Geox, British Knights, eigentlich bin ich da relativ flexibel (sofern ich nichts von Camel Active finde). Bugatti, Lacoste und Nike gehen aber gar nicht.
- Bekleidung (25 %): Boss lohnt zwar einen Blick, ist aber nicht erste Wahl, Hilfiger hat einige schicke T-Shirts, Wrangler hat einige schicke Hemden und sehr leidensfähige Jeans. Tom Taylor oder Abercrombie & Fitch sind keine Option, ebenso wie Kleidungsstücke, die mich zum Werbeträger für eine Marke machen. Früher war S.Oliver erste Wahl (aber die haben sich geschmacksmäßig von mir entfernt); seit meiner Abkehr von S.Oliver bin ich wieder auf der Suche nach der Marke meines Vertrauens. Dafür habe derzeit einen ziemlich bunten Kleiderschrank ;-) C&A passt nicht zu mir, und H&M passt mir zu selten, als dass ich einen Besuch dort noch erwägen würde (obwohl vor 15 Jahren mein Lieblingshemd von H&M war – aber in den Folgejahren hat sich dort kein vergleichbares Kaufglück ergeben).
- Taschen (100 %): Vaude hat die richtige Kombination aus Qualität, Preis und Praxistauglichkeit. Bei Camel Active gibt’s ebenfalls praktische Exemplare, ebenso hat Samsonite einen Blick verdient. No name geht gar nicht mehr, da habe ich zu viele schlechte Erfahrungen mit Spontankäufen.
Macht mich eine solche Aufstellung zum Marken-Junkie? Ich glaube nicht. Die genannten Beispiele basieren auf meinen Erfahrungen, und mein Auswahlprozess ist ziemlich herausfordernd – sonst hätte ich beispielsweise in den vergangenen sieben Jahren bereits einen Nachfolger für S.Oliver gefunden. So mäandere ich bei der Bekleidung zwischen den Angeboten umher und bin auf Spontanentdeckungen angewiesen. Bei Bekleidung ist meine Markenorientierung von früher 75 Prozent auf nunmehr 25 Prozent gesunken, d.h. ich achte weniger auf bestimmte Marken, sondern stöbere durch die konkreten Produkte, die jeweilige Herstellermarke hat dann nur noch einen ergänzenden Einfluss auf die Kaufentscheidung.
Bekenntnis
Aus der Erkenntnis, dass S.Oliver bei mir nicht mehr der Default für den Bekleidungskauf ist und sich bislang kein klarer Nachfolger zu erkennen gab, entstand überhaupt erst das Nachsinnen über Marken und deren Auswirkungen auf den Einkaufsalltag. Früher war es für mich recht einfach gewesen: Ich brauche (oder möchte) ein neues T-Shirt, neue Hose, Hemd oder ähnliches – also gehe ich in den S.Oliver-Store (Geschäft oder online) und fertig. Das geht nicht mehr. Während ich früher oft zwei oder drei Teile gekauft habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte, finde ich dort heute oft nicht mal eines, das ich in die engere Wahl nehmen möchte.
Nun habe ich allerdings auch nicht vor, für ein T-Shirt 100 Euro zu bezahlen oder für eine Hose gar 200. Damit scheiden zahlreiche (bekannte oder Edel-)Marken aus. Die übrigen drucken oft so aufdringliche Motive oder ihre Marken auf, dass sie sich für mich disqualifizieren. Ein dezenter Herstellerhinweis ist völlig in Ordnung, aber ich möchte niemanden optisch anbrüllen, dass ich ein Shirt von XYZ trage, oder mit irgendeinem pseudo-klugen Spruch oder hippen Bildmotiv die Aufmerksamkeit auf ein Kleidungsstück fokussieren. Wer sich mit mir unterhält, soll mir ins Gesicht sehen und nicht von grellen Farben auf meiner Brust abgelenkt werden.
Ich verstehe auch nicht die Klage der Frauen, dass man ihnen nur auf den Busen schauen würde – wenn dort aber ein Spruch oder Bildmotiv aufgedruckt sind, wandert der Blick durchaus dorthin. Schließlich möchte man ja in Erfahrung bringen, wer der Gegenüber ist.
Marken helfen mir jedenfalls, im Angebots-Dschungel den Überblick zu behalten und Entscheidungen zu treffen. Weiß ich von einer Marke, dass ihr Schnitt nicht für meine Statur geeignet ist, so spare ich Lebenszeit und mir die wiederholte Erkenntnis (oder Demütigung), dass es mit deren Kleidung und mir einfach nicht funktionieren wird. So geschehen bei Drykorn, die wirklich schicke Sachen haben, aber an mir sehen sie immer falsch aus.
Bei Unterhaltungselektronik ist es das gleiche. Würde ich beispielsweise alle verfügbaren Soundbars evaluieren, testen und mich eingehend mit der Materie beschäftigen, wäre ich heute noch mit der Forschung beschäftigt. So haben wir seit drei Monaten eine Soundbar von Panasonic. Sie hat einen guten Klang und erfüllt unsere Anforderungen. Sicher, es gibt bessere, aber die gewählte passt zu uns. Letztlich muss man sich entscheiden: Möchte man ewig nach der besten aller Optionen suchen oder die Lebenszeit lieber mit dem Nutzen der nicht ganz perfekten, aber geeigneten Lösung verbringen?
Und – das ist die Erkenntnis – Marken helfen dabei, das Feld der geeigneten Lösungen so einzugrenzen, dass es überschaubar und damit beherrschbar wird. Statt aus hunderten oder gar tausenden Modellen zu wählen, wird aus wenigen Dutzend oder wenigen Modellen gewählt.
Marken sind quasi aus Lebenserfahrung gewonnene Vor-Entscheidungen.
Erfüllen Produkte von No-name-Marken nicht auch ihren Zweck?
Ja, natürlich, das T-Shirt von einem x-beliebigen Anbieter erfüllt den grundsätzlichen, funktionalen Zweck: Ich bin bekleidet. Für viele Käufer ist damit das Thema hinreichend geklärt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Stoffe sich besser anfühlen und bequemer tragen. Gern darf der Schnitt auch etwas raffinierter ausfallen oder ein kleines Detail das Trage-Erlebnis aufwerten. Diese Aspekte finde ich allerdings bei vielen Produkten nicht erfüllt.
Für Billig-Marken rentiert sich der bessere Stoff nicht (der ja nicht wirklich besser sein muss, sondern sich einfach nur besser anfühlt). Die Margen sind knapp, und Markentreue ist bei Preis-Marken kein relevantes Auswahlkriterium. Wer gute Erfahrungen mit „Ja“-Käse gemacht hat, wird deshalb nicht unbedingt den „Ja“-Joghurt bei Rewe kaufen. Vielmehr signalisiert das „Ja“-Logo auf dem Joghurtdeckel, dass es in all der Joghurt-Auswahl günstige Exemplare gibt. Die Marke agiert hier eher als Preisindikator denn als eigenständiges Versprechen (jenseits von „gut genug“).
Marketing und Marken
Natürlich betreiben Marken Marketing, Werbung, Image-Pflege und dergleichen mehr, um uns Kunden für sie einzunehmen. Was das beste Marketing jedoch nicht vermag: Ein als schlecht erlebtes Produkt in ein positives Erlebnis umkehren. Marketing kann nur dann effektiv funktionieren, wenn es erfolgreiches Erwartungsmanagement betreibt. Werbe-Versprechen, die das Produkt nicht einhält, führen zur Marken-Abkehr.
Konkretes Beispiel. Mein letztes Nicht-Smartphone war das Nokia C5. Angeblich konnte man damit surfen, eMails schreiben und dergleichen mehr. Nur in der Praxis fühlte es sich dermaßen ungeeignet für diese Aufgaben an, dass ich nicht mal im Notfall auf den Browser zurückgegriffen habe – lieber habe ich jemanden angerufen und um die rasche Online-Recherche gebeten. Auch wenn die Software sicher leistungsfähig und zu all den Marketingbehauptungen in der Lage war, so fehlte ihr doch die passende Hardware. Das Gerät war dermaßen träge, dass der Großteil der Fehleingaben dadurch passierte, dass die Bildschirmansicht noch nicht aktualisiert war. Das ist beim SMS-Schreiben, Adressbuch-Durchstöbern oder bei einer Geräteeinstellung kein angenehmes Erlebnis, führt vielmehr zu Dauerfrust, und ich habe es letztlich vermieden, das Gerät zu viel mehr als zum Uhrzeitablesen zu verwenden.
Nach vielem Ausprobieren bin ich dann beim iPhone 4 gelandet. Dies konnte alles, was mir Nokia versprochen hatte – und zwar so gut, dass ich es gern dazu benutzte. Coolstes Feature: die Schiebetaste zum Lautlos-Stellen. Statt umständlich in den Menüs herumzuhangeln, konnte ich nun beim Beginn eines Meetings mit einer kleinen Fingerbewegung auf Stumm schalten. Und dieses Feature war nirgendwo im iPhone-Marketing herausgestellt oder erwähnt worden – für mich war es das alltagsbereicherndste und -vereinfachenste Feature von allen!
Das iPhone hat eine Marketing-Weisheit von Guy Kawasaki mit Leben gefüllt: Underpromise and overdeliver – versprich nicht zu viel und übertriff die Erwartungen!
Marketing ist keine Gehirnwäsche
Gern wird behauptet, dass (vor allem Edel-) Marken nur dank ihres Marketing noch existieren und dass ihre Verkaufszahlen zu (hohen) Preisen nur durch Marketing erzielt würden. Konkret lautet die Behauptung: „Ohne Marketing würde niemand Apple-Produkte kaufen.“ Der Vorwurf wird letztlich gegenüber jeder (Edel-)Marke erhoben, deren Produktvorzüge für den Vorwerfenden nicht plausibel scheinen, vom Auto über Bekleidung bis zur Bohrmaschine. Die argumentative Flucht auf den Vorwurf der irrationalen Marketingwirkung geschieht dann, wenn der Vorwerfende die Produktunterschiede entweder nicht rational bewerten kann bzw. mag oder ihm diese Produktunterschiede nicht den Aufpreis wert scheinen – seine persönliche Wertewelt also von der anderer Kunden abweicht.
Das Marketingargument ist aber zu kurz geschossen. Erstens gibt es einen Unterschied zwischen Marketing und Gehirnwäsche. Kein geistig gesunder Mensch wird ständig Produkte von einer Marke kaufen, die ihn belügt. Insofern muss Marketing der Wahrheit verpflichtet bleiben, zumindest sollte sie nichts versprechen, was das Produkt nicht im Kundensinne auch einlöst.
Zweitens wird von Marken erwartet, dass diese Markenbildung betreiben. Coca Cola schmeckt seit Jahrzehnten gleich, dennoch wird immer noch für dieses Getränk geworben. Marketing und Werbung definieren, wie sich das Produkt versteht, wo es sich (im Marktgefüge) positioniert und welche Erwartungen Kunden an es haben können.
Natürlich verkauft sich ein Produkt besser, wenn es positive Gefühle und Assoziationen in der Werbung suggeriert. Es verkauft sich aber bald gar nicht mehr, wenn die tatsächlich eintretenden Gefühle so gar nicht zum versprochenen passen wollen, wenn also statt Freiheits- und Glücksgefühl plötzlich Übelkeit beim Cola-Trinken eintreten. Werbung und Marketing können positive Gefühle nur überhöhen, aber keine Gefühlswelten umkehren.
Marketing ist Positionierung
In Marketing und Werbung positionieren sich die Hersteller und verraten, wer aus ihrer Sicht die Zielgruppe und was die Anwendungsfälle für die Produkte sind. Gerade bei Mode-Marken ist dabei entscheidend, ob sich der potenzielle Käufer zu dieser Zielgruppe zählen möchte oder nicht. Möchte er zu der hippen und coolen Avantgarde-Welt gehören, die ihm die Werbebilder suggerieren? Oder möchte er einfach nur gemütlich seinem Sachbearbeiter-Dasein nachgehen?
Mit zunehmender Reife fallen die Käufer seltener auf falsche Zielgruppen herein. Zu viele „besseres Ich“-Klamotten haben sie sich gekauft. Sachen, die sie zwar gern tragen würden, sich aber nicht trauen oder nicht wirklich reinpassen oder nie die passende Gelegenheit haben werden. Und mit jedem Fehlkauf werden sie ein wenig vorsichtiger.
Sie greifen eher zu Bewährtem – so wie sie ihren Ehepartnern, Freunden, Verwandten und dem alten Auto die Treue halten. Das gibt ihnen Halt im Alltag und reduziert die Komplexität, unter der sie zu ersticken drohen.
Bei weniger reifen bzw. gesättigten Kunden kann (gutes!) Marketing den Wunsch auslösen, das Produkt einer bestimmten Marke zu probieren. Passen Versprechen und Erleben zusammen und erfolgt geeignetes soziales Feedback, kann daraus Markentreue entstehen. Das soziale Feedback des Kunden kann selbst die beste Marketing-Abteilung allenfalls indirekt beeinflussen, da ist viel „Zeitgeist“, Cliquentum und vor allem Glück vonnöten. Warum manche Marken in bestimmten Kundensegmenten eine Zeitlang „chic“ und „angesagt“ sind, ist kaum vorherzusagen und eine der zahlreichen Wellen auf dem Markenmeer – sie klingt also ab und macht der nächsten Platz.
Schnell outen sich reife Personen, wenn sie ihre Jugend wiederhaben möchten. Sie kaufen Produkte einer „hippen“ Marke. Dabei verkennen sie, dass diese Marke bereits seit einigen Jahren gar nicht mehr „hip“ ist. Wer jung bleiben will, darf keiner Markentreue verfallen, sondern muss ständig agil auf der Suche nach dem nächsten „coolen Ding“ bleiben. Dazu muss man natürlich auf die komfortable Komplexitätsreduktion und Risikominimierung durch Vertrauen in Marken verzichten.
Mein Essay über Marken in vier Teilen
- Überblick: Wie Marken funktionieren und ihre Bedeutung sichern
- Konsumentenperspektive: Marken bestimmen und koordinieren unseren Einkaufsalltag.
- Historische Perspektive: Marken entstanden aus Prestige und handwerklichem Renommee.
- Unternehmerperspektive: Marken sind mehrdimensional und erfordern konstante Arbeit.

 ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||
ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||